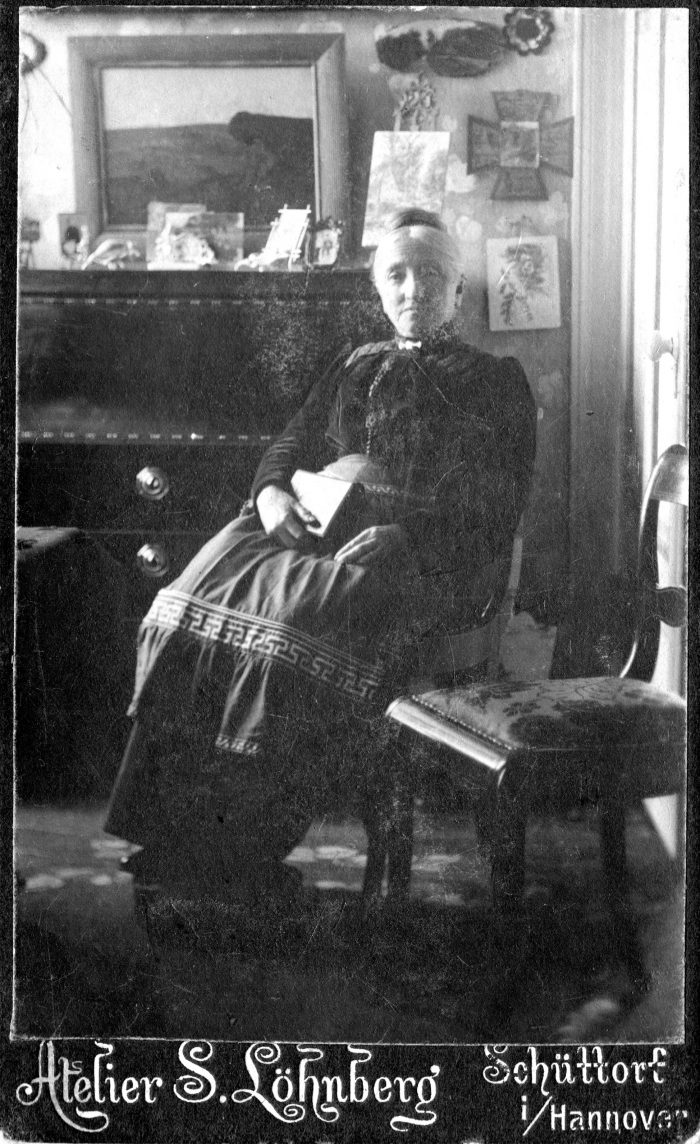In Schüttorf gibt es zahlreiche Bräuche, die zum Teil eine sehr lange Tradition aufweisen. Die wenigsten sind hier in Schüttorf entstanden, viele wurden von anderen Orten und Regionen übernommen und teilweise auch mit einer erheblichen Portion Lokalkolorit versehen. Einige Bräuche sind längst in Vergessenheit geraten, andere erst vor wenigen Jahren hinzugekommen.
Bräuche sind immer ein Bestandteil der lokalen Kultur einer Stadt, einer Region, eines Ortes. Sie sind von Region zu Region sehr unterschiedlich. Was sie eint, ist ihr Zweck, nämlich der Sinn- und Identitätsstiftung. Und sie dienen vor allem auch der Bildung von Gemeinschaftsgeist und Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer sozialen Schicht.
Geister verbrennen
Viele Bräuche haben einen religiösen Hintergrund. Nicht alle entstammen originär dem Christentum, sondern sind aus vorchristlichen Religionen in die Zeit des Christentums übernommen und angepasst worden. So zum Beispiel das Osterfeuer. Es ist germanisch-heidnischen Ursprungs und diente der Vertreibung der Wintergeister.
Das Osterfeuer gehört schon seit langen Jahren zu den festen Bräuchen, die in unserer Stadt gefeiert wurden. In der Form, wie wir es heute kennen, stammt es wohl aus dem westfälischem Raum. Wann das erste Osterfeuer in Schüttorf brannte, ist nicht belegt. Es ist aber anzunehmen, das aufgrund des starken reformierten Einflusses, ein Osterfeuer sehr lange verpönt und vielleicht sogar verboten war.
Spätestens im 19. Jahrhundert begannen vor allem Kinder in den einzelnen Stadtvierteln (Kluften) vor Ostern damit, Holz, Reisig, aber auch brennbare Abfälle zu sammeln und auf einer naheliegenden Fläche rund um einem hohe Holzpfahl aufzustapeln. Dieser Holzhaufen wurde dann am Karfreitag-Abend angezündet. Später brannten die Osterfeuer erst am Ostersonntag oder Ostermontag.
Für die Kinder und Jugendlichen war das Osterfeuer natürlich ein großer Spaß und auch eine kleine Einnahmequelle. Denn von den Schaulustigen rund um das Osterfeuer wurde ein kleiner Obolus erbeten. Heute gibt es in Schüttorf nur noch wenige Osterfeuer. Das große Osterfeuer auf dem Kuhm wird von der Jugendfeuerwehr organisiert. Durch den Verkauf von Getränken und Grillwürsten wird die Vereinskasse ein wenig aufgefüllt.
Gehorsam war erste Bürgerpflicht
Der älteste dokumentierte Schüttorfer Brauch ist der Schüttorfer Bürgereid. In den Jahren nach der Stadtgründung wurden Neubürger in Schüttorf nur am 22. Januar, dem Petritag, in die Bürgergemeinschaft aufgenommen. An diesem Tag wurde traditionell auch der Rat der Stadt gewählt. Bei ihrer Neuaufnahme mussten die Bürger einen Treue- bzw. Gehorsamseid ablegen und versprechen, dass sie der „Stadt Schüttorf und dero gemeines Beste nach allen Vermögen suchen und befördern wollen, alles Arge meyden, und was der Stadt und dem gemeinen Besten schädlich, trewlich abwenden helfen wollen, auch diejenige, so der Stadt vorgesetzt, ehren und gehorchen.“ Der Bürgereid wurde auf dem Marktplatz und später dann vor dem Rathaus abgelegt. Natürlich gab es dabei auch ein Rahmenprogramm, bei dem viel Bier und Wein floss.
Der König durfte heiraten
Um die Stadt vor Feinden zu schützen wurde unmittelbar nach der Vollendung der Stadtbefestigung die Bögerscüttery ins Leben gerufen. In ihr mussten alle Bürger im wehrfähigem Alter dienen. Die Bögerscüttery übernahm zudem auch die Aufgabe des Brandschutzes und der Brandbekämpfung. Als Dankeschön und Anerkennung für den Einsatz der jungen Schüttorfer Männer wurde einmal im Jahr, am zweiten Sonntag nach Pfingsten, auf Kosten der Stadt ein Schützenzech veranstaltet. Auf einem freien Platz außerhalb der Stadtmauern fanden Wettkämpfe der Schützen statt. Vor allem wurde mit der Armbrust, später dann mit Feuerwaffen, auf einen „Vogel“ geschossen, der auf einem hohen Pfahl angebracht war. Wer den Vogel abschoss, wurde zum „Schützenkönig“ ernannt. Dieser Titel war bei den jungen Männer sehr begehrt, denn ein Schützenkönig erhielt die Erlaubnis auch dann zu heiraten, wenn er zum Beispiel noch kein Meister war oder kein eigenes Haus besaß. Später wurde der Schützenzech vor und im Rathaus gefeiert.
Rosinen auf der Leiter
Viele in Schüttorf zelebrierte Bräuche waren an die einzelnen Lebensabschnitte der Menschen gebunden. Das fing bei der Geburt an. War ein Kind geboren, so brachten die Nachbarn, später dann auch Freunde und Bekannte, den jungen Eltern einen großen Weggen. Der Weggen ist ein langes Weizenbrot, dass mit viel „guter Butter“ und vielen Rosinen oder Korinthen gebacken wird. Beim ersten Kind war der Weggen meist einen Meter lang. Er wurde von Kind zu Kind immer länger.
Zum Weggenbringen versammelten sich die Männer der Nachbarschaft in einheitlicher Kleidung. Meist wurde der dunkle Sonntagsanzug getragen. Auf dem Kopf thronte ein Zylinder. Und alle trugen Holzschuhe. Als weitere Zierde hatte man ein rotes Halstuch oder ein rotes Tuch, das um den Zylinder gebunden wurde.
Mit einer Leiter bewaffnet ging es dann zum Bäcker, um dort den Weggen abzuholen. Der kam auf die Leiter und wurde in einem kleinen Umzug zum Elternhaus des Neugeborenen getragen. Unterwegs legte man an so mancher Gaststätte einen Zwischenstopp ein, bei dem man gerne einem Bier oder Söpken zusprach. Bei den Eltern angekommen, wurde der Weggen alsbald angeschnitten. Die Scheiben belegte man mit Wurst, Schinken oder Käse. Sie wurden meist mit Heißhunger verzehrt. Der Rest des Weggens kredenzte man am Taufsonntag des Kindes den Gästen der Tauffeier.
Tauhalten und ewige Liebe
Um die Hochzeiten ranken sich viele kleine Bräuche, die mehr oder weniger intensiv gefeiert wurden. Sie begannen schon vor der eigentlichen Trauung. Dann trafen sich die Nachbarn, um das Haus des Brautpaares mit dem Hochzeitsgrün zu schmücken. Es wurde aus Tannengrün ein Bogen gebunden, der später vor der Eingangstür angebracht war. Den Hochzeitsbogen verzierte man mit kleinen weißen Röschen aus Stoff oder Papier. Einen Hochzeitsbogen gab es nur für die „erste“ Hochzeit. Wenn ein Witwer oder eine Witwe erneut heiratete, wurde in der Regel kein Bogen mehr aufgestellt. Heute wird das aber nicht mehr so „eng“ gesehen. Hochzeitsbögen gibt es heute auch zu Silbernen, Goldenen oder Diamantenen Hochzeiten.
Zur Hochzeitsfeier wurden früher die Gäste durch den sogenannten „Hochzeitsbitter“ eingeladen. Meist war das der nächste Nachbar, der die Gäste aufsuchte und sie persönlich zum Fest einlud. Er wusste natürlich auch darüber Bescheid, mit welchem Geschenk man dem jungen Paar eine große Freude bereiten konnte.
Am Vorabend einer Hochzeit feierten die Freunde und Bekannten des Brautpaars den „Brandewein“. Zuerst kehrten die Männer beim Bräutigam ein, um mit reichlich Klarem und Bier den Durst zu löschen. Dann zog die Herrschaften weiter zum Haus der Braut, wo sie versuchten, mit einer deftigen Erbsensuppe wieder etwas nüchtern zu werden.
Am Tag der Hochzeit schlug die Stunde der Kinder. Wenn das Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft die Kirche verließen, standen dort Kinder Spalier und versperrten mit einem Hochzeitstau dem Hochzeitspaar den Weg. Das musste sich mit Süßigkeiten oder Geld den Weg freikaufen.
Nach der kirchlichen Trauung ging die ganze Hochzeitsgesellschaft im Hochzeitsmarsch von der Kirche zur eigentlichen Hochzeitsfeier. Viele Hochzeiten wurden damals noch zu Hause des Bräutigans oder der Braut gefeiert. Beim Zubereiten des Essens und bei der Bewirtung der Gäste halfen natürlich die Nachbarn kräftig mit. Es war auch üblich, dass die Nachbarn dem Brautpaar ein Ständchen vortrug. Meist wurde dafür zu einer mehr oder weniger bekannten Melodie ein neuer Text geschrieben, in dem Geschichten aus dem Leben des Brautpaars in lustiger und manchmal auch derber Form vorgetragen wurden. Nicht selten wurden dabei auch Dinge aufgedeckt, die der Braut oder dem Bräutigam bis dahin unbekannt waren. Aber Sitte und Anstand mussten trotzdem gewahrt bleiben, soweit es der Alkoholpegel noch zuließ.
Der nächste Nachbar
Ohne eine gute Nachbarschaft war das oftmals nicht einfache Leben in Schüttorf nicht zu ertragen gewesen. Deshalb hatten die Nachbarschafts-Bräuche immer einen hohen Stellenwert für die Menschen.
Wer in den Kluften und Rotten der Innenstadt wohnte, der hatte immer einen „Nächsten Nachbarn“. Der „Nächste Nachbar“ war der erste Nachbar, an dem man auf dem Weg zur Kirche vorbei kam. Er war eine wichtige Vertrauensperson der Familie. Ihn bat man um Rat, aber auch um Tat. Der „Nächste Nachbar“ lud zu Hochzeits- oder Tauffeiern ein und organisierte die Feierlichkeiten. Er sagte bei Verwandten und Bekannten den Todesfall eines Familienmitgliedes an, organisierte die Totenwache, die Sargträger und die Totenfeier oder den Leichenschmaus, auch Grove genannt.
Der „Nächste Nachbar“ war auch der Ansprechpartner, wenn es um die Nachbarschaftshilfe ging. Wurde ein Haus gebaut, so halfen alle Nachbarn nach ihren Möglichkeiten mit. Oder er organisierte Unterkünfte, wenn ein Brand oder ein Sturmschaden das Haus unbewohnbar gemacht hatte. Der „Nächste Nachbar“ kümmerte sich auch darum, dass im Krankheitsfall die Kinder versorgt wurden. Aber er wurde auch zu Schlichtung hinzugerufen, wenn ein Ehestreit den Haussegen mächtig schief hängen ließ.
Eine gute Nachbarschaft war den Schüttorfer wichtig. Deshalb wurde sie immer gepflegt. So trafen sich in den Abendstunden manche Nachbarn vor dem Haus, setzten sich auf kleine Bänke und niedrige Fenstersimse, um zu plaudern oder das eine oder andere Bier zu trinken. Die Nachbarsfrauen trafen sich regelmäßig am Nachmittag zum Kaffeekränzchen, das nicht selten mit dem einen oder andere Glas Aufgesetzten beendet wurde.
Natürlich gab es nicht in jeder Straße eine gute Nachbarschaft. Aber wo es eine gab, da war das Leben einfach leichter zu meistern.
Einen kleinen Brauch will ich hier noch erwähnen, den Nachbarschaftsrundgang am Neujahrsmorgen. Nach dem Kirchgang ging der jüngste Nachbar zum nächst älteren und holte ihn ab. Nach einem Söpken marschierten die beiden weiter zum wiederum nächst älteren. Das ging so weiter bis alle männlichen Nachbarn bei ältesten Nachbarn eingetroffen waren. Dort wurde dann bei Neujahrskuchen und alkoholischen Getränken auf das Neue Jahr und die gute Nachbarschaft angestoßen.
Grove und andere Totenbräuche
Natürlich spielten beim Tod eines Menschen Bräuche eine große und wichtige Rolle. Bei einem Todesfall kommt neben der Trauer auch viel Arbeit auf die Hinterbliebenen zu. Da half man sich in Schüttorf gegenseitig.
Die Toten wurden in früheren Zeiten meist zu Hause in ihrem Bett aufgebahrt. Man durfte die Toten nicht sofort beerdigen, sondern sollte 3 Tage damit warten. In dieser Zeit kamen Verwandte, Bekannte, Nachbarn und Arbeitskollegen ins Trauerhaus, um Abschied von dem Toten zu nehmen.
Vor der Beerdigung, die spätestens nach dem dritten Tag erfolgen musste, wurde der Tote in den Sarg umgebettet. Vor dem Haus wartete dann der „Leichenwagen“, auf den der Sarg gehoben und mit Kränzen bedeckt wurde. Der Leichenwagen war ein spezieller Wagen, meist mit schwarzem, glänzendem Holz verkleidet. Er wurde von Pferden gezogen. Hinter dem Leichenwagen reihte sich die Trauergesellschaft auf, angeführt vom Pastor oder Pfarrer und den nächsten Angehörigen. Ihnen folgte meist in Zweierreihe die übrigen Trauernden. Dann ging es durch die Straßen der Stadt zu Friedhof, wo am offenen Grab eine kurze Trauerfeier abgehalten wurde. Erst danach versenkte man den Sarg mit dem Verstorbenen in das offene Grab. Alle Schüttorfer, die in den Straßen einem Trauerzug begegneten, hielten für kurze Zeit inne und gedachten des Toten. Bei wichtigen Persönlichkeiten begleitete auch hin und wieder eine Musikkapelle den Trauerzeug.
Nach der Beerdigung trafen sich die geladenen Trauergäste zu Grove. Die Grove war ein Leichenschmaus, bei dem oft Kaffee und der sogenannte Beerdigungskuchen verzehrt wurden. In früheren Jahren wurde für die Grove auch schon mal ein Schwein oder eine Ziege geschlachtet. Dann gab es Braten und fette Wurst. Nicht selten endete die Grove in einem feuchten und dann auch fröhlichen Umtrunk. Auch um zu zeigen, dass nun die Zeit der Trauer vorbei sei und das Leben weiter geht.
Im Tau durch Wald und Feld
Das Dautrappen (Tau treten) ist ein in den protestantisch geprägten Gebieten Nordwestdeutschlands und Westfalens verbreiteter Brauch. Unter „Tau treten“ verstand man eine früh am Morgen startende Wanderung von meist jungen Männern, die durch Wald und Wiesen führte, die zu der Tageszeit oft noch von Tau bedeckt waren.
Woher dieser Brauch stammt und woher er kam, ist nicht belegt. Vielfach wird darauf hingewiesen, dass es sich vielleicht um einen Ersatz für Prozessionen gehandelt haben könnte, die ja in der protestantischen Kirche nicht so üblich waren. Andere vermuten den Ursprung in einer Zeremonie, die den Göttern des Waldes/der Natur gewidmet waren. Für Schüttorf ist eine lange Tradition des Dautrappens aber nirgendwo belegt.
Dautrappen wurden aber auch in Schüttorf veranstaltet. Wie andernorts auch üblich am Himmelfahrtstag. Junge Männer zogen in kleineren oder größeren Gruppen durch die naheliegenden Felder, Wiesen und Wälder. Oft hatten die Gruppen ein gemeinsames Ziel, in der Regel ein Ausflugslokal in der näheren Umgebung. Dort wurden an diesem Tage vielfach Tanzveranstaltungen angeboten. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts zogen viele junge Männer aus Schüttorf am „Vatertag“ Richtung Bad Bentheim zum Kurhaus, wo sie auf andere Jünglinge aus Bentheim oder den umliegenden Bauernschaften trafen. Nicht selten endete dieses Treffen in einer handfesten Rauferei.
Stand in früheren Jahren noch die Lust am Wandern, an der frischen Luft, an Flora und Fauna im Vordergrund, so dient das Dautrappen heute vor allem dazu, einen mäßigen bis übermäßigen Alkoholgenuss zu zelebrieren.
Friesische Klumpen
Durch den überregionalen Handel aber vor allem auch durch den Zuzug von Menschen aus anderen Regionen kamen auch deren Bräuche in die Obergrafschaft. Dazu zählt auch das Kloatscheeten, das wohl aus dem niederländischen Friesland zu uns gekommen ist. Bereits 1630/31 ist in einem Bentheimer Kirchenprotokoll die Rede vom „Spielen mit Bollen und Kloet“.
Kloatscheeten wird vor allem in Friesland in verschiedenen Varianten als Bosseln oder auch Klootschießen gespielt. Es wird angenommen, dass sich auch dieses Spiel aus einer Kriegstechnik entwickelt hat. So sollen die Friesen Klooten (Klumpen) aus Lehm als Wurfgeschosse eingesetzt haben, die bei den Gegner durchaus gefürchtet waren. Später entwickelt sich daraus ein Spiel, bei dem nicht selten Mannschaften aus rivalisierenden Dörfern gegeneinander antraten. Dann endete das Spiel oft in einer Massenschlägerei. Kein Wunder, dass das Kloatscheeten immer wieder von der Obrigkeit verboten wurde.
Beim Kloatscheeten, wie es hier in Schüttorf gespielt wird, wird vor dem Spiel ein Start- und Zielpunkt festgelegt. Dann kommt es darauf an, eine mit bleigefüllte abgerundete Scheibe so weit wie möglich zu werfen. Bis zu der Stelle, wo die geworfene Scheibe zum Stillstand kommt, darf die jeweilige Mannschaft vorrücken. Ziel ist es, mit möglichst wenigen Würfen den festgelegten Zielpunkt zu erreichen. Kloatscheeten wird vor allem in den Wintermonaten meist auf Feldwegen gespielt.
Kinder und Könige
Eine nicht ganz so lange Tradition wie die großen Schützenfeste haben in Schüttorf die Kinderschützenfeste. Dokumentiert sind sie vor allem für den Ausgang des 19. Jahrhunderts bis hin in die Mitte des 20. Jahrhundert.
Zu den einzelnen Kinderschützenfesten versammelten sich die Kinder der Nachbarschaften oder Kluften. Sie spielten in meist fantasievollen Kostümen die großen Schützenfeste nach. Natürlich wurde dabei auch in kleinen Wettkämpfen ein Kinderschützenkönig nebst Thron erkoren. Für die Kinder war es, wie Beteiligte berichten, eine große Ehre, einmal auf dem Thron eines Kinderschützenfestes zu landen.
Eine Maut für die Kinder
Ebenfalls ein Kinderbrauch war das Aufhängen der Pfingstkrone. Sie war aus Stroh oder Tannengrün geflochten und mit Blumen und bunten Bändern verziert. Die Pfingstkrone wurde an „strategisch günstigen“ Stellen aufgehängt. Jeder Erwachsene, der unter der Pfingstkrone herlief, wurde mit der Frage „Hebbts Se noch nen Deut voor de Pingstekrone?“ angehalten, einen kleinen Obolus zu entrichten. Leider ist dieser Brauch, wie so manche andere auch, heute in Vergessenheit geraten.
Von Birken, Fahnen und Festen
Die Schüttorfer Schützenfeste können, wie schon beschrieben, auf eine sehr lange Tradition zurückblicken. Jahrelang war der Gilde-Schützenverein der alleinige Schützenverein in unserer Stadt. Bei der „Gilde“ waren vor allem Bürger aus der Innenstadt organisiert. Er galt deshalb auch immer als der Schützenverein der „besseren Leute“. Der Einfluss der Gilde ging so weit, dass viele Arbeitgeber ihren Angestellten und Arbeitern am Montag des Schützenfestes einen ganzen oder halben Tag frei gaben.
Erst im 20. Jahrhundert etablierten sich zwei weitere Schützenverein. Achte de Bahn wurde der Adler Schützenverein gegründet und später dann im Osten der Stadt der Bürger-Schützenverein. So gab es in den letzten Jahrzehnten immer drei Schützenfeste zu feiern.
Schützenfeste waren aber nicht nur Feste für die jeweiligen Vereinsmitglieder, sondern immer auch Stadtteilfeste. Entsprechend wurden zum Schützenfest die Straßen und Plätze der Stadt festlich geschmückt, durch die der jeweilige Festumzug marschieren sollte. Das Schmücken der Straßen mit Fähnchen und jungem Birkengrün war schon selbst ein kleines Fest. Einige Tage vor dem Start des Schützenfestes zogen die Männer der zu schmückenden Nachbarschaften in die Wälder, um jungen Birkenbäume zu schlagen. Die wurden an frisch getünchte Latten oder Stöcke gebunden, die man am Straßenrand aufstellte. Dann wurden die Fahnengirlanden aus dem „Winterlager“ geholt und auf der Straße entrollt. Dabei wurde überprüft, ob sie Schaden genommen haben. Mussten kaputte Fähnchen ausgetauscht werden, so nähten die Frauen der Nachbarschaft flugs neue, natürlich in den jeweiligen Farben des Schützenvereins. Waren alle Fahnengirlanden komplett, begann man die Fahnengirlanden aufzuhängen. Wo es ging, spannte man sie über die Straßen hinweg, ansonsten hängte man sie entlang der Straßen auf.
Natürlich war das „Schmücken“ der Straßen immer begleitet von feucht-fröhlichen Umtrunken, die machmal so früh anfingen, das bei den letzten aufzuhängenden Fahnen kein Erwachsener mehr so sicher auf den Beinen war, dass er gefahrlos auf die Leiter steigen konnte. Dann mussten das die älteren Kinder übernehmen, die dann mit einem Glas Regina oder Brause belohnt wurden.
Die Helden vom Kuhm
Die Schüttorfer Kirmes gehörte Jahrzehnte lang zu den wichtigsten Volksfesten, die in Schüttorf gefeiert werden. Ursprünglich war die Kirmes ein Fest, das an dem Tag der Kirchweihe gefeiert wurde. Ob dies auch in Schüttorf der Fall war, ist nicht bekannt. Dokumentiert ist allerdings, dass auf verschiedenen Märkten, die in der Stadt abgehalten wurden, auch Spiel- und Vergnügungsbuden zugelassen waren, später dann auch Karussells. Die erste Kirmes in Schüttorf, so wie wir sie kennen mit Fahrgeschäften, Los- und Wurfbuden, Kuriositätenkabinetts etc., fand wohl erst um die Jahrhundertwende auf dem Kuhm statt. Der bis dahin auf dem Marktplatz abgehaltene Jahrmarkt wurde zu der Zeit dorthin ausgelagert.
Die Schüttorfer Kirmes war immer ein Stadtfest, zu dem nur hin und wieder auch auswärtige Besucher kamen. Dazu war die Kirmes zu klein und bot auch nicht genügend Attraktionen. Aber für die Schüttorfer war sie ein Highlight im Jahr. Und das nicht nur für die Kinder. So war es lange üblich, dass in kleinen Handwerksbetrieben der älteste Geselle vom Meister am Kirmesmontag ein Kirmesgeld in die Hand gedrückt bekam. Dann zog er mit den anderen Gesellen und Lehrlingen los auf die Kirmes. Dort kaufte er von des Meisters Geld allen Bratwurst, Getränke oder Süßigkeiten.
Für die heranwachsenden Jugendlichen, den damals sogenannten Halbstarken, war die Kirmes auch ein kultureller Höhepunkt. So traf man sich gerne an der Raupe oder dem Autoselbstfahrer. Um zu posieren, und vor allem auch, um Musik zu hören. Denn dort wurde die aktuelle Musik gespielt, die man sonst in Schüttorf nur selten zu Gehör bekam.
Und natürlich war die Kirmes für die Jugendlichen ein wichtiger Anlass, um zarte Bande zu knüpfen. So etwas wie Discos oder Tanzclubs gab es zu der Zeit nicht in Schüttorf.
Für viele Kinder und Jugendliche war die Kirmes, trotz der im Vergleich zu heute sehr moderaten Preise, immer ein teures Vergnügen. Ein paar Fahrten mit dem Karussell, ein Los an der Losbude oder eine Portion Zuckerwatte, schon war man pleite. Da traf es sich gut, dass viele Schausteller für den Aufbau von Fahrgeschäften und Buden tatkräftige Helfer suchten. Natürlich packte man da gerne mit an. Denn belohnt wurde die Arbeit mit Freifahrt- oder anderen Gutscheinen. Hatte man genügend davon erarbeitet, war man zumindest für eine Kirmes ein Held auf dem Platz. Besonders, wenn man dann noch als Kartenkontrolleur auf der Raupe oder beim Autoselbstfahrer eingesetzt wurde. Und es war auch schon ein wenig Abenteuer mit dabei, in die ganz andere Welt der Schaustellerei einzutauchen. Nicht wenige Schüttorfer Jugendliche kamen angesichts der zahlreichen Schilder „Junger Mann zum Mitfahren gesucht“ durchaus in Versuchung. Und der eine oder andere hat der auch nicht widerstehen können.
Manchen Brauch braucht niemand mehr
Soweit meine kleine Aufzählung der Schüttorf Brauche. Sie erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und die Gewichtung erfolgte rein subjektiv. Zudem sind im Laufe der Jahre auch viele neue Bräuche entstanden, die man heute schon zum Brauchtum in unserer Stadt zählen kann.
(Fotos: Stadtarchiv Schüttorf, Heimatverein Schüttorf, privat Müller, privat Schrader, privat Bomfleur, privat Franke)